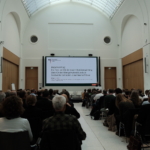Der Fachkongress, den das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) gemeinsam mit dem Verband AGDW – Die Waldeigentümer ausrichtete, machte deutlich, dass Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (FWZ) entscheidend dazu beitragen können, das Potenzial des deutschen Waldes für Klimaschutz und regionale Wertschöpfung vermehrt auszuschöpfen. Damit dies gelingt, bedarf es allerdings geeigneter Rahmenbedingungen, die darauf ausgerichtet sind, die nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Holzmobilisierung gezielt zu stärken.
Im Mittelpunkt der Diskussionen standen auf dem diesjährigen BUKO aktuelle Herausforderungen durch politische Vorgaben ebenso wie langfristige Strategien für die bundesweit mehr als 1.500 Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse.
Schlüsselrolle von FWZ im ländlichen Raum
Die Parlamentarische Staatssekretärin im BMLEH, Martina Englhardt-Kopf, würdigte in ihrer Rede auf dem BUKO den hohen Stellenwert Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. „Zur Mobilisierung des Holzpotenzials, insbesondere im Kleinprivatwald, für die Holzvermarktung und als Partner im ländlichen Raum kommt den Zusammenschlüssen eine Schlüsselrolle zu. Diese wollen wir weiter stärken“, erklärte die Staatssekretärin. In diesem Zusammenhang ging sie auch auf die Umsetzung der EU-Verordnung zu entwaldungsfreien Produkten (EUDR) ein, nachdem die EU-Kommission die erneute Verschiebung des EUDR-Geltungsbeginns vorgeschlagen hatte. „In Staaten wie Deutschland findet keine Entwaldung statt und vor diesem Hintergrund ist die Schaffung einer Null-Risiko-Variante in der EUDR dringend geboten, um unnötige Belastungen für Waldbesitzende in Deutschland und für die FWZ abzuwenden“, sagte Englhardt-Kopf.
Regionaler EUDR-Ansatz
AGDW-Präsident Prof. Andreas Bitter begrüßte die von der EU-Kommission initiierte Verschiebung der EUDR und das Bekenntnis der Staatssekretärin zu einer Null-Risiko-Variante, wie sie die Bundesregierung auch im Koalitionsvertrag festgehalten hat. Im Sinne einer praxisgerechten Umsetzung der Verordnung warb der AGDW-Präsident für einen regionalen Ansatz bei einer solchen Null-Risiko-Variante. Die Architektur der Verordnung könne damit erhalten bleiben. „Mit einem solchen Ansatz lässt sich sowohl der Marktzugang insbesondere für kleine Betriebe gewährleisten als auch die Wirksamkeit der EUDR verbessern“, betonte der AGDW-Präsident. Er ging auf weitere Fallstricke für die Forstwirtschaft durch EU-Vorgaben ein, so bei der Wiederherstellungsverordnung (W-VO), und erinnerte an die Zusage im Koalitionsvertrag, bei der W-VO für Erleichterungen zu sorgen.
Aktivposten für den Kleinprivatwald
Andreas Täger, Sprecher des Initiativkreises Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse (IK) bezeichnete die Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse als Aktivposten für den Kleinprivatwald: „Mit dem ehrenamtlichen Engagement ihrer Vorstände sind die Zusammenschlüsse eine Stütze für gesellschaftliche Stabilität im ländlichen Raum. Und mit innovativen Geschäftsmodellen weisen FWZ immer häufiger den Weg in eine Zukunft der Forstwirtschaft, deren Einkünfte auf mehreren Säulen steht.“ Solch Innovationen gelte es weiter zu fördern und auszubauen.
Große fachliche Breite im Programm
In fünf Schwerpunkt-Foren, sogenannten Thementischen, wurden beim Kongress weitere fachliche Akzente gesetzt, von Fragen des Steuerrechts und der Sozialversicherung über die Rolle von FWZ bei der Umsetzung von Fördermaßnahmen bis hin zu erfolgreicher Social Media-Arbeit.
An anderer Stelle wurde in ebenfalls fünf Gruppen die forstliche Förderpolitik der Bundesländer vorgestellt, verglichen und Bedarfe mit Angeboten abgeglichen.
Nachhaltige Wirkung für die Zukunft unserer Wälder
„Sei es die Beratung und Betreuung der Mitglieder zu forstlichen Dienstleistungen, die Durchführung der Waldpflege, der Betrieb von Bioenergieanlagen oder weitere Geschäftsfelder: Der Bundeskongress hat klar vor Augen geführt, welch nachhaltige Wirkung die Arbeit Forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse für die Zukunft unserer Wälder und für die Wertschöpfung im ländlichen Raum hat. Damit diese positiven Effekte künftig weiter zum Tragen kommen, ist es maßgeblich, dass die politischen Entscheidungen in Deutschland und der Europäischen Union fach- und sachgerecht unter Berücksichtigung der Erfahrung der Waldbesitzenden und ihrer Organisationen getroffen werden“, betonte Prof. Bitter.
Die Fachvorträge finden Sie hier: www.buko-fwz.de/programm
Bildquellen BMLEH und AGDW/Sebastian Runge